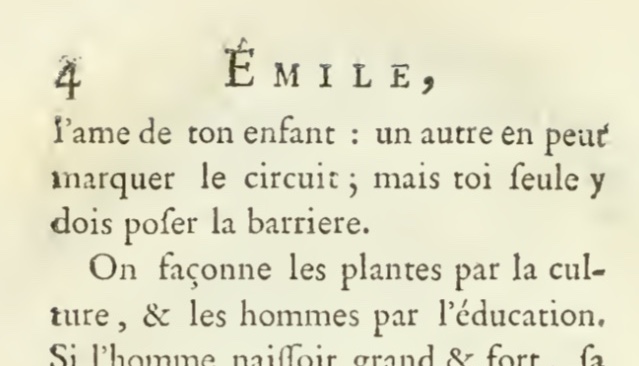Auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (http://dgfe2018.de) haben Juliane Engel und ich gemeinsam ein Symposion zum Thema “Bildung und Design” veranstaltet. Die Diskussonen zwischen Vortragenden – Claudia Mareis, Heidrun Allert, Juliane Engel, als Critical Friend Manuel Zahn – und Teilnehmer*innen waren ausgesprochen anregend; mit Sicherheit ist dies ein Thema, das wir weiter verfolgen werden.
Hier meine kurze Einführung:
Zur Einführung: Pädagogik als Subjektdesign
Benjamin Jörissen
benjamin.joerissen@fau.de
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Einführungsvortrag zum Symposion „Bildung und Design“, 26. Kongress der DGfE, 21.3.2018
cc-by-nd 4.0
(pdf)
1. „Postdigitalität“
Wenn im Titel dieses Symposions von „post-digitalen Transitionen“ die Rede ist, dann ist das zunächst erklärungsbedürftig. Schließlich hat der Digitalisierungshype, wenn auch mit einiger Verzögerung, die Politik, und insbesondere die Bildungspolitik, ergriffen. Besser spät als nie fragen wir also gegenwärtig nach Wirkungen, Formen, Gestaltungsmöglichkeiten von „Digitalisierung“, die dabei teilweise als disruptiver Handlungsauftrag – „alles muss verändert und digital rationalisiert werden“ – verstanden wird, teilweise als Tsunami-artige Welle wahrgenommen wird, die mit lebensweltlichen, materiellen, kommunikativen, sozialen, ökonomischen, infrastrukturellen, politischen – kurz gesagt also: mit kulturellen Umbrüchen auf ganzer Breite einhergeht. Das Präfix „post“ steht vor diesem Hintergrund für die These, dass Digitalität längst nicht mehr nur da wirksam ist, wo Strom, Akkus und Gadgets involviert sind, sondern dass sie ein Strukturphänomen darstellt, dass also Strukturaspekte des Digitalen zunehmend gesellschaftliche und kulturelle Prozesse tiefgreifend prägen. Dafür steht beispielsweise die Transformation hin zu fraktalisierten und individualisierten vernetzten Öffentlichkeiten, stehen neue Verknüpfungen von Sichtbarkeit. Bildlichkeit und Identität, neue Praktiken des Gebrauchs des Gedächtnisses im Zeichen kommunikativer Vernetzung und digitalisierter Wissensbestände; dafür steht auch eine signifikante Veränderung materieller Umwelten und Dingwelten, die immer mehr zu „smarten“, dinglich-digitalen Hybriden werden (Bsp. digital vernetzte KFZ). Die postdigitale Welt in diesem Sinne ist eine Welt, Logiken der Moderne aufgreift, weiterführt (z.B. Innovation als Prinzip), transformiert (z.B. Modi und Formen der Individualisierung), radikalisiert (z.B. Überwachung/Daten-Panoptismus) und dabei teilweise auch überschreitet (Disruption als ökonomisches Prinzip; Bsp. Uber, AirBNB).
In der postdigitalen Kultur wird damit auch ein genuines Phänomen der Moderne, insbesondere der industrialisierten Massengesellschaften, aufgegriffen und ubiquitarisiert, nämlich das Phänomen des Designs. Design ist hierbei als Prozess der Hervorbringung von Arrangements zu verstehen – seien es dingliche, mediale, informationale, infrastrukturelle, kommunikative, räumliche, soziale, ökologische oder prozessuale Arrangements –, die sich durch implizite Wissensformen im Hinblick auf Szenarien ihres Gebrauchs auszeichnen.
2. Subjektivation qua Design
„Design“ stellt in diesem Sinne nicht „Dinge“ oder „Designobjekte“ her, sondern seine ästhetischen Formgebungen konzipieren Relationen zwischen Dingen, materiellen Umwelten und Lebewesen. Zum manifesten Objekt wird das Design erst als Verhältnis zu diesen antizipierten Relationen, die ihrerseits mithin auf normativen Grundlagen basieren. Als Objekt jedoch, als designtes Ding oder designte Umgebung, trägt es struktural diese antizipierten Relationen als Potenzial ihrer je konkreten Verwirklichungen in sich. Die solchermaßen aus einer umfassenden Vorwegnahme späterer Relationierungsszenarien hervorgehende, immer schon ökonomische (auf industrielle Massenherstellung ausgerichtete) Designwelt stellt, wissenstheoretisch betrachtet, ein völlig anderes Paradigma dar als die sukzessive Formung von Gegenständen aus historisch relativ invariablen Erfahrungszusammenhängen heraus, wie sie für vormoderne Dingwelten typisch war. Wie diese aber stellt Design jeweils Angebote bereit, auf bestimmte Weise zum Nutzer eines Dinges zu werden. Praktiken im Umgang mit Dingen, die sich als „Nutzung“ verstehen, sind auch Praktiken des Selbst, die den „Nutzer“ (oder auch den „Konsumenten“, den affirmativen, kritischen oder goutierenden „Rezipienten“, den kreativ sich artikulierenden „Prosumenten“) als eine Weise des Selbstverständnisses überhaupt erst hervorbringen. Die Regelmäßigkeit affirmativer Gebrauchsformen lässt Subjekte zu den Nutzern und Objekte zu den affordanten „Devices“ werden, die ein Design projektiert: ein Prozess, der mithin „compliance“ (Butler 2001, 22) – ein Einverständnis oder auch nur eine Inkaufnahme, die de facto eine Anerkennung darstellt – beinhaltet.
3. Design als Erziehungsakteur – Erziehung als Designphänomen
Auf diese Weise wird und wirkt Design implizit erzieherisch, wie dies im Designdiskurs des Bauhaus auch expliziert wurde. So schreibt Klaus Hörning: „Es war in den Augen der Bauhäusler der entwurzelte Massenmensch der Großstadt, der durch eine neue Baukunst zu Einfachheit, Klarheit und Sachlichkeit gebracht werden sollte. Es waren die Dinge, die Gebäude, das Haus, seine innere Ausgestaltung, die Raumanordnung des Mobiliars, die Geräte, die man dem Massenmenschen andiente“ (Hörning 2012, 30). „Bauen“ meint in diesem Sinne, so Torsten Blume (2009, 249) „eine fundamentalistisch und universalistisch ausgerichtete Gestaltertätigkeit, die die räumliche ‚Organisation von Lebensvorgängen‘ ebenso meinte, wie das elementare Erzeugen von räumlichen Wirkungen durch Formen, Farben, Licht und Bewegungen“. Der Industriedesigner Dieter Rams (bekannt für seine Entwürfe für die Marke „Braun“ im Geiste der bauhauhaffinen „Ulmer Schule“) nennt als ein Ziel seiner Arbeit im Nachkriegsdeutschland, „dass man den Menschen durch bessere Architekturen und bessere Gestaltung zum besseren Menschen erziehen könne. Durch eine neutrale, nicht emotional oder ideologisch aufgeladene Umgebung sollten die Deutschen zu Demokraten gemacht werden.“
Die Bedeutung des Erzieherischen des Designs ergibt sich aber nicht nur aus dieser Sachlage, sondern es betrifft das Erzieherische selbst. Einerseits reflektiert es seinen Designaspekt nur sehr selektiv, in der Regel bezogen auf Lernumgebungen und instructional design; neuerdings in Bezug auf Pädagogik als Form praxisbasierten Wissens, oder wie man vielleicht in Anlehnung an Mareis (2011) sagen könnte: als Wissenskultur sui generis, die daher auch über Zugänge des design based research erschlossen werden könne – als „bridge between scientific knowledge production and practice design“ (Dieter Euler in der 2017 neu gegründeten Zeitschrift EDeR – Educational Design Research: An International Journal for Design-Based Research in Education).
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Design ein Phänomen der Modernisierung ist, liegt darin aber, über alle wichtigen pragmatischen Bezüge hinweg, auch die Frage nach der Geschichte der Pädagogik als Geschichte pädagogischer Designs. Es ist vielleicht ein weiterer „vergessener Zusammenhang“ im Verhältnis von Bildung und Kultur. Pädagogik, die im Zuge von Modernisierungsprozessen ein selbstreflexives Unternehmen wurde (Mollenhauer 1983), das sich mit der Fragen seiner Wirkungsgrundlagen zugleich mit der Frage der durch Erziehung repräsentierten und performativ tradierten Weltbilder auseinandersetzen musste, hat sein Technologiedefizit durch Designs gelöst. Nicht Ursache/Wirkungs-Zwänge, sondern Angebote der Bezugnahme, Relationierungsangebote, stehen im Zentrum des Erzieherischen. Ist Erziehung wesentlich ein Zeigeprozess (Prange), so liegt diesem Zeigen das Bezeichnen, Zeichnen und Entwerfen – disegno – zugrunde. Dabei sind die Zeichen dieses Zeigens nicht nur Gesten humaner Akteure, sondern Designs medialer/mediendidaktischer (Comenius, Orbis Pictus) environmentaler (Rousseau, Emile), ästhetischer (Schiller, Briefe) architektonischer (Bentham, Panoptikon) und dinglicher (Froebel, Spielgaben) Art. Sie enthalten je spezifische Moralisierungsprogrammatiken und spezifische Subjektentwürfe, und sie wirken – performativ – aus sich heraus.
4. „Pädagogik als Subjektdesign“ …
… zu betrachten geht mit der Aufforderung einher, implizite Wissenformen (insbesondere auch hegemoniales Wissen, das sich auch der reflexiven Erziehungswissenschaft nicht leicht erschließt) in pädagogischen Ding-Raum-Körper-Arrangements methodologisch erfassbar machen und hinsichtlich ihrer subjektivierenden, performativen Effekte empirisch zu befragen. Es bedeutet, Bedingungen affirmativer und nichtaffirmativer Relationierungsweisen zu erforschen, dabei interdisziplinäre Bezüge zu Desgindiskursen – etwa auch des kritischen, non-intentionalen und partizipatorischen Designdiskurses – auf pädagogische Praxis und Praktiken anzuwenden (Allert/Richter); es bedeutet, auch Pädagogik als Designprozess, und d.h. als Wissensprozess und Wissenskultur (Mareis) verstehen und zu befragen. Nicht zuletzt bedeutet es vor dem Hintergrund des material turn in der Erziehungswissenschaft, Bildung nicht auf einen in „Köpfen“ stattfindenden Prozess beschränken, sondern als körperlich-materielles und ästhetisches, Relationierungsgeschehen und Subjektivationspraxis theoretisch wie empirisch zugänglich zu machen (Engel).